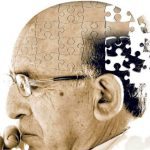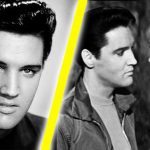Im Jahr 2012 stießen Forscher in einer sibirischen Höhle auf ein kleines Knochenfragment, das zunächst als unscheinbares Fossil neben einer Sammlung tierischer Überreste abgelegt wurde. Ursprünglich ging man davon aus, dass es sich um ein weiteres Exemplar des bereits zwei Jahre zuvor entdeckten Denisova-Menschen handelte, einer frühen Menschenart aus dem Altai-Gebirge.
Das Fragment blieb lange unbeachtet, bis Wissenschaftlerinnen am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie es im Rahmen einer Inventur erneut untersuchten. Eine Forscherin bemerkte dabei Auffälligkeiten in der DNA, die zunächst wie ein Fehler erschienen. Die Analyse zeigte jedoch, dass der Knochen einem etwa 15-jährigen Mädchen gehörte.
Die genetische Untersuchung enthüllte ein außergewöhnliches Ergebnis: Das Mädchen war ein Nachkomme eines Denisova-Menschen und einer Neandertalerin. Dieses hybride Erbgut eröffnete neue Erkenntnisse über die frühe Menschheitsgeschichte und die Interaktionen verschiedener Hominidenarten.
Vergleichende Studien an 144 Meerkatzen zeigten, dass unterschiedliche Populationen trotz äußerlicher Unterschiede erfolgreich Nachkommen erzeugen konnten. Dieses Prinzip lieferte Hinweise darauf, wie frühe Menschenarten in gemeinsamen Lebensräumen genetisch interagierten. Auch Beispiele aus der Tierwelt, wie Kreuzungen zwischen Grizzly- und Braunbären, illustrieren, dass Hybriden sowohl in freier Wildbahn als auch unter bestimmten ökologischen Bedingungen entstehen können.
Für die Forschung bedeutet dies, dass Veränderungen im Lebensraum, wie klimatische Verschiebungen oder geographische Migrationen, entscheidend für die Vermischung unterschiedlicher Arten waren. Die Entdeckung des Denisova-Mädchen-Knochens liefert damit einen wichtigen Baustein für das Verständnis der menschlichen Evolution und zeigt, wie komplex die genetische Geschichte unserer Vorfahren tatsächlich war.