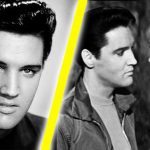Forscher haben erstmals seit etwa anderthalb Jahren den Zerfallsprozess eines menschlichen Körpers unter natürlichen Bedingungen umfassend visuell dokumentiert. Langzeitaufnahmen zeigten, dass sich Leichname im Sarg über einen längeren Zeitraum hinweg deutlich dynamischer verhalten als bislang angenommen, was in der Fachwelt Aufmerksamkeit und teilweise Überraschung ausgelöst hat.
Das Projekt wurde am Australian Facility for Taphonomic Experimental Research (AFTER) durchgeführt, einer auf die Untersuchung der Leichenzerfallprozesse spezialisierten Einrichtung auf der Südhalbkugel. Dort werden unter realistischen Umweltbedingungen Veränderungen an Kadavern systematisch erfasst, um Modelle der Taphonomie — der Leichenverwesung und ihrer Umgebungswirkungen — zu überprüfen und zu verfeinern.
Für die Studie wurde eine automatisierte Kamera installiert, die in regelmäßigen Abständen — etwa alle 30 Minuten — Bildmaterial erfasste. Die Beobachtungsdauer erstreckte sich über siebzehn Monate; die so gewonnenen Daten ermöglichten eine detaillierte Analyse zeitlicher Abläufe und wiederkehrender Muster im Zerfallsgeschehen.
Die Auswertung der Aufnahmen ergab, dass es in der Phase nach der Beisetzung zu verschiedenen, vorher nicht in diesem Umfang antizipierten Bewegungsphänomenen kommen kann. Die Wissenschaftler betonten allerdings, dass es bei der Interpretation der Aufnahmen vor allem darum gehe, natürliche physikalische und biologische Prozesse zu identifizieren — etwa Gasausdehnungen, Gewebeveränderungen und Einflüsse von Insekten oder Mikroorganismen — und nicht um eine mystifizierende Darstellung des Phänomens.
Aus anthropologischer Sicht wurde bereits früher darauf hingewiesen, dass der Umgang mit Leichen kulturell stark geformt ist: Überall auf der Welt existieren Rituale und Praktiken, die darauf abzielen, Kadaver schnell und kontrolliert zu beseitigen oder zu bestatten. Solche Maßnahmen lassen sich auch mit gesundheitlichen Erwägungen erklären, denn ungeordneter Verwesungsprozess kann lokale ökologische und hygienische Risiken bergen.
Das Forschungsprojekt am AFTER dient daher nicht nur der grundlagenwissenschaftlichen Erforschung der Taphonomie, sondern hat auch praktische Relevanz — etwa für Gerichtsmedizin, Bestattungswesen und den Umgang mit Überresten in Katastrophenfällen. Die gewonnenen Beobachtungen sollen helfen, bestehende Zerfallmodelle zu präzisieren und die zeitliche Abfolge typischer Verwesungsstadien unter klimatischen Bedingungen der südlichen Hemisphäre besser zu beschreiben.
Abschließend wiesen die beteiligten Wissenschaftler darauf hin, dass die Ergebnisse in einen größeren Forschungskontext eingeordnet werden müssen: Einzelstudien liefern wichtige Befunde, bedürfen jedoch weiterer Replikationen und vergleichender Untersuchungen, um verallgemeinerbare Schlussfolgerungen zu ermöglichen.